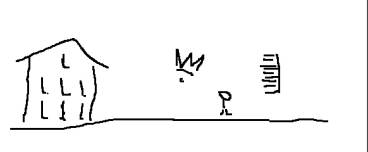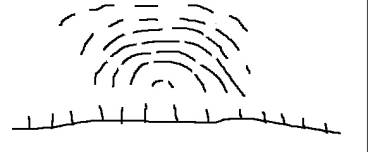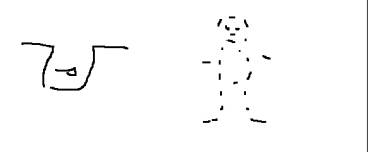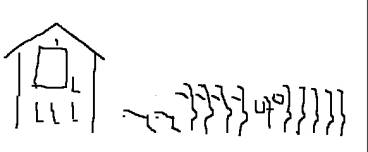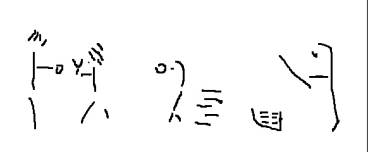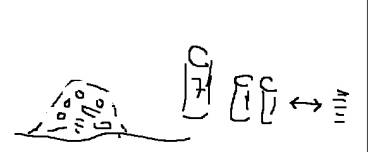|
König, kleine Steine Erinnerungen Vorwort
Es gibt Erinnerungen die sich tief ins Gedächtnis
einprägen. Manche Geschehnisse bleiben als Bilder oder sogar wie ein Film auch nach Jahrzehnten so lebendig als ob sie sich
gerade erst ereignet hätten. Selbst Gerüche wecken Assoziationen an längst
Vergangenes. Wie zum Beispiel 1948 anlässlich der Weihe des späteren
Kardinals Julius Döpfner zum Bischof von Würzburg. Wir sollten als Schüler
des Realgymnasiums an der Straße Spalier stehen um der vorbeiziehenden
Prozession zur Neumünsterkirche Ehre zu erweisen. Das war viel zu langweilig.
Deshalb kletterten wir in die Ruinen, um das Schauspiel von oben anzusehen.
Die Geschäftsbücher des Kaufhauses lagen zuhauf als verkohlte Papierstapel
herum. Sie strömten noch immer den Brandgeruch des Bombenangriffs vor 3
Jahren aus. Heutzutage sehe ich beim Grillen, wenn der Qualm hochsteigt,
ungewollt die scharzen noch nicht völlig zur Asche zerfallenen Überreste der
ehemaligen Geschäftigkeit. Auch scheinbar Unwichtiges hinterlässt
unvergäng-liche Eindrücke. Das geschah ebenfalls bei der Prozession zur
Neumünsterkirche. Nach den kirchlichen Würdeträgern schritten die Ehrengäste
in dem langen Zug. Die Damen trugen weiße Handschuhe, die bis zu den
Ellenbogen reichten. Ein unvorstellbarer Luxus im Jahre 1948. Nicht nur
Bilder und Gerüche hinterlassen Ihre Eindrücke im Gedächtnis. Auch Geräusche
und Stimmen bleiben ein Leben lang erhalten. Das Dröhnen der
Flugzeuggeschwader klingt beim Kreisen eines Motorfliegers unweigerlich im
Ohr und lässt mich ducken, gleichsam wie einer Gefahr entgehen. Und die Worte
meines Vaters "König, kleine Steine" wirkt nach, wenn es gilt eine
Aufgabe zu erledigen. König,
kleine Steine Erinnerungen eines 7-jährigen Februar
1945. Wir wohnten am Ortsrand Würzburgs in einem Dorf in einem
2-Familien-Siedlerhaus im 1. Stock. Eine Wohnung, geteilt mit einer anderen
Familie. Über uns im Dach wohnten Herr und Frau König. Frau König hatte ein knatschrotes Gesicht. Es wurde geflüstert, sie benutze eine Wurzelbürste zum Waschen. Seife war damals Mangelware. Vielleicht stimmte das Gerücht - oder auch nicht.
Herr König hinkte ein wenig und er war für mich schon alt. Im Nachhinein schätze ich ihn auf 40, aber als Siebenjähriger findet man das schon sehr alt. Er war gar nicht eingezogen, warum das so war wusste ich nicht, wahrscheinlich hing es mit seiner Behinderung zusammen, vielleicht eine Kriegsverletzung. Ich dachte auch nicht weiter darüber nach. Unter
uns wohnte der Hausbesitzer Müller mit Frau und zwei Töchtern. Er hatte einen
Hund, der wurde überfahren. Herr Müller war sehr traurig, was sollte er mit
dem toten Hund machen? Beerdigen? Eigentlich zu schade. Er setzte in einem
großen Topf Wasser auf, zerlegte den Hund und kochte eine feine Suppe. Ich
durfte auch davon probieren. Einen
wackligen Milchbackenzahn zog er mir mit einer alten rostigen Flachzange. Es
blutete nur ein ganz klein wenig. Das kannte ich schon, es war ja nicht der
erste Zahn.
Herr
Müller war tatsächlich schon alt, pensionierter Schul-Hausmeister. Er
fütterte eine Ziege, mehrere Stallhasen und eine Hühnerschaar auf seinem
großen Grundstück. Früher hatte man dort sogar Wein angebaut. Weil er zu
sauer war, wurde die Winzerei aufgegeben. Es gab außerdem einen Steinbruch. Einige größere
Kalksteinblöcke lagen noch herum. Das Interessanteste waren die beiden
Brennöfen für die Kalkherstellung. In Betrieb waren sie schon lange nicht
mehr. Sie lagen im Berghang, oben ein riesiges gemauertes Loch, das war der
Einwurf in den die Steine gekippt wurden und unten ein tunnelartiger Zugang
in der Größe einer Kammer, wo wohl das Feuer gemacht wurde um den Kalk zu
brennen und wo der gebrannte Kalk herausgeschafft wurde. Bei
Fliegeralarm rannten wir immer in den Keller. Damals wurde Schweinfurt
bombardiert. Das kannten wir schon aus dem Rheinland, wo wir vor der
Evakuierung wohnten. Wir sahen den roten Feuerschein am Himmel und wussten
was dort geschah. Meinem Vater schien der Keller jetzt nicht mehr sicher
genug. Das Haus wäre bei einem Bombentreffer sicher völlig zerstört worden
und wir wären nicht mehr lebend heraus gekommen. Dazu kam die Angst vor
Artilleriebeschuss und den anrückenden Amerikanern.
Mein
Vater war nicht im Krieg. Er hatte viel mit der Lederversorgung zu tun und
deshalb musste er zu Hause bleiben - uk-gestellt hieß das. In einer
stillgelegten Matratzenfabrik war das Lederlager eingerichtet worden. Leder
war damals etwas ganz Wertvolles. Man bekam dafür alles: Brot, Butter, Stoff
und sogar Zement. Davon wurden eines Tages auf einem Karren einige Säcke
angeliefert. Das war spannend! Tags darauf trommelte mein Vater alle Hausbewohner
zusammen und erklärte sein Vorhaben: "Der Brennofen wird zum
Luftschutzbunker umgebaut". Die Öffnung zwischen dem Einwurf und der
Kammer wurde zugemauert. Dann wurden in den Einwurf von oben ganz viele
Steine gekippt, bis die Öffnung reichlich zugedeckt war.
Anschließend wurde vor dem Eingang eine dicke
zweischalige Mauer als Splitterschutz gebaut. Die Erwachsenen schleppten
große, schwere Steine für die Außenseiten herbei. Die Arbeit ging schnell
voran. Zwischen die Außenseiten kamen kleinere Steine als Füllmaterial. Das
ging nicht so schnell, zumal es die Aufgabe von Herrn König war. "König,
kleine Steine!" rief mein Vater alle paar Minuten, "König, kleine
Steine" und wieder "König, kleine Steine!" Als
die Mauer fertig war, ging es an den Innenausbau. Aus Latten wurden
Etagenbetten zusammengenagelt. Eine alte Autobatterie wurde mit ein paar
Taschenlampenbirnchen verbunden, das war die Beleuchtung. Bei jedem
Bombenmalarm stürmten wir von da an über den Hof in unseren Bunker. Am
16. März 1945 kam mein Vater gegen Abend nach Hause. Er hatte mit einigen
Freunden gefeiert, irgendwie hatten sie ein paar Flaschen Wein aufgetrieben
und geleert. Es war wieder Bombenalarm. Von Ferne hörte man das Dröhnen der
Flugzeuge. Wir standen vor dem Bunker. Schon wieder Schweinfurt? Das Dröhnen
kam näher und dann wurde es am Himmel bunt. "Christbäume" schwebten
herab, zwei oder drei Kilometer von uns entfernt mitten über Würzburg. Wir
verzogen uns in den schützenden Bunker. Und dann ging es los.
Detonation
auf Detonation, ein Gewitter aus Explosionen und Krachen. Der Himmel voll
Rauch und Feuer. Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte. Zwischendurch
ging mein Vater hinaus, um sich das "Schauspiel" anzusehen. Voller
Verzweiflung und Sarkasmus rief er "Das muss doch kaputt zu kriegen
sein, das muss doch kaputt zu kriegen sein!" Nun, er hat Recht bekommen.
Würzburg, eine Lazarettstadt ohne kriegswichtige Bedeutung lag in Schutt und
Asche. Der
Angriff war vorüber. Wir verließen unseren Bunker. Die Straße aus Würzburg
führte an unserem Haus vorbei. Ein endloser Zug von Menschen bewegte sich
stadtauswärts. Männer mit einem Bein auf Krücken, andere den Kopf dick
verbunden, wieder andere die Arme in Gips: Das waren die aus den Lazaretten.
Wieder andere mit Kindern an der Hand oder auf dem Arm, Frauen, alte Leute,
abgerissen, verdreckt, gebeugt, mit schleppendem Gang: Die übrige
Bevölkerung. Sie zogen an uns vorüber, die ganze Nacht.
Ein
Freund meines Vaters kam gegen Mitternacht zu uns mit seiner Frau.
Nachmittags hatten sie noch zusammen gefeiert. Sie hatten eine Holzfigur dabei,
es war alles was sie gerettet hatten. Der Mann legte sich bäuchlings auf
unsere Couch und meine Mutter zog ihm mit einer Pinzette die Splitter aus dem
Rücken. Von
diesem Tag an gingen wir Kinder nicht mehr zur Schule. So konnte ich sehen,
wie auf dem Dorfplatz der Volkssturm exerzierte. Das war ein
zusammengewürfelter Haufen von Männern, die nicht zum Kriegsdienst eingezogen
waren, wegen Untauglichkeit oder Unabkömmlichkeit. Mein Vater winkte mir zu,
als der Vorgesetzte gerade mal nicht hinsah. Der Volkssturm musste längs der
Straße Löcher ausheben. Dort sollten sie sich verstecken und die angreifenden
Feinde zurückschlagen. Dazu hatten sie sogar ein oder zwei Panzerfäuste
bekommen. Mein Vater war für den Nahkampf mit einer Pistole bewaffnet. Einige
Wochen später zogen eines Tages wieder viele Männer auf der Straße an unserem
Haus vorbei, einzeln oder in kleinen Gruppen, Soldaten auf dem Rückzug zu
einer Auffanglinie irgendwo ein paar Kilometer weiter. Die Frauen aus der
Nachbarschaft kochten in unserem Hof in einem großen Kessel eine Suppe, deren
Hauptbestandteil warmes Wasser war. Die Soldaten nahmen es dankbar an. Es war
eine aufgeregte und gleichzeitig fast heitere Stimmung an diesem Tag.
Mein
Vater vergrub seine Pistole auf dem Grundstück unseres Hausbesitzers. Ich
erzählte irgendwo stolz, ich wüsste, wo die Pistole liegt. Als ich
nachschaute, ob sie immer noch da liegt, war sie nicht mehr da. Ich bekam am
Rande mit, dass mein Vater nicht glücklich war, dass ich mit meinem Wissen
über das Pistolenversteck angegeben hatte. Jedenfalls durfte ich von da an
nicht mehr an das Telefon gehen, egal wie lange es klingelte. Das Verbot war
derart unmissverständlich und absolut, dass ich noch viele Jahre später
Probleme hatte zu telefonieren.
Für
das Verbot gab es noch einen weiteren Grund: Der Ortsgruppenführer war
plötzlich verschwunden. Man brauchte einen neuen Mann für diesen Posten. Als
schnell verfügbarer Ersatz wurde mein Vater auserwählt. Das erfuhr er durch
eine Indiskretion der Tochter des Hausbesitzers, die in der
Gemeindeverwaltung arbeitete, eine halbe Stunde vor dem Erscheinen der Leute,
die ihn auserkoren hatten. Dieser Posten hätte ihm größte Probleme bereitet,
wenn die Amerikaner, deren Einmarsch in Kürze zu erwarten war, dies erfuhren.
Er musste deshalb von einem Moment zum anderen verschwinden und sich für
einige Tage verstecken. Niemand durfte erfahren, wo er sich aufhielt. Auch
der kleinste Hinweis hätte ihn das Leben kosten können. Als er zwischendurch
einmal unerwartet auftauchte, wurden im Küchenherd viele Bücher verbrannt.
Bücher verbrennen ist gar nicht so einfach. Die Asche erstickt die Flamme.
Die Ringe der Herdplatte wurden heraus genommen, um mit dem Schürhaken die
Asche durch den Rost in den Aschkasten zu stochern. Ich verstand das Vorgehen
nicht, weil wir doch im Herbst genügend Holz gemacht hatten.
Baumstämme waren
zersägt, zu Scheiten zerhackt und an der Hauswand aufgeschichtet worden. Es
war noch ein reichlicher Vorrat vorhanden. Ganz schlimm fand ich, wie er mein
Spielzeuggewehr über dem Knie auseinanderbrach und auch ins Feuer steckte.
Man hätte es doch hinter der Haustüre vor den Feinden verbergen können,
meinte ich. Mein Vater war unbarmherzig: "Wenn die das sehen, glauben
die, wir wollten uns gegen sie wehren, dann erschießen sie uns". Ich
habe geweint, nicht wegen des Erschießens, sondern um das Gewehr. Wenige
Tage später erschien ein Jeep aus Richtung Würzburg. Er blieb einige Zeit am
Ortsrand stehen und drehte dann wieder um. Das erschien mir sehr merkwürdig.
Nicht lange danach hörte man den Ortsdiener mit seiner Schelle die Straße
entlang kommen. Alle sollen weiße Fahnen heraushängen war seine hektisch
verkündete Botschaft. Weiße Fahnen? So etwas war nicht vorgesehen. Ein
Bettlaken als Fahnenersatz war jedoch schnell gefunden und hing wenige
Minuten später aus dem Schlafzimmerfenster heraus an der Hauswand. Die
anderen Häuser zeigten in gleicher Weise die Bereitschaft ihrer Bewohner,
sich friedlich auf den Empfang der Befreier einzustellen. Und
dann kamen sie. Tief gebückt die ersten Reihen, das Gewehr im Anschlag, jeden
Moment bereit sich hinzuwerfen und auf alles zu schießen. Danach aufrecht
gehend, das Gewehr in der Hand. Eines fiel mir auf: die strammen Hintern in
den Uniformen.
Kurz
zuvor hatte ich ja noch den deutschen Rückzug erlebt: schlotterige Hosen an
abgemagerten Männern. Eine ältere Nachbarin wuselte sich, mit einer Hand
taschentuchschwenkend, quer durch die Marschkolonnen der Amerikaner, einen
Krug mit Magerbier in der anderen Hand. Ich bekam Angst um sie, aber niemand
tat ihr was. ein irrationales Geschehen. Gegenüber
von unserem Haus war eine Wiese. Die "Amis" hoben viereckige flache
Löcher aus und stellten Artilleriegeschütze hinein, die auf unser Haus
zeigten. Ein Junge, der ein bisschen Englisch konnte, wurde hingeschickt um
zu fragen, ob das für uns gefährlich sei. Sehr lässig gab man ihm Bescheid,
es würde uns nichts passieren, die Granaten würden über unser Haus und den
dahinter liegenden Hügel fliegen auf die jenseitigen deutschen Stellungen,
wir könnten beruhigt schlafen. Dennoch suchten wir in unserem Bunker Schutz.
Ich
weiß nicht, wie lange die Geschütze dort standen. Wahrscheinlich waren es nur
ein paar Tage bis sie weiterzogen. Dafür erschienen jetzt ganz andere Amis.
Sie verlangten, dass wir innerhalb von ein paar Stunden unsere Wohnung
verlassen. Alle Möbel mussten da bleiben, nur das Notwendigste und Tragbare
durfte mitgenommen werden. Wir zogen in die stillgelegten Werkhallen der
Matratzenfabrik, in der das Lederlager untergebracht war. Alles war primitiv
und provisorisch. Als Kind nimmt man das einfach so hin. Es ist halt so, eher
ein Abenteuer. Im
anschließenden Teil der Werkhallen wurden Truppen einquartiert.
"Schwarze". Ich konnte sie erst überhaupt nicht auseinanderhalten,
sie sahen für mich alle gleich aus. Meine Mutter hatte Angst vor
Vergewaltigungen. Deshalb wurde eine Ausgangstür des Lagers als Notausgang
hinter einem Schrank versteckt. Doch die "Schwarzen" waren sehr lieb. Meine Mutter machte mit
ihnen Tauschgeschäfte: Sie erhielt eine Zitrone, damals etwas Besonderes.
Dafür bekamen die "Schwarzen" einen Schnaps. Eigentlich waren diese
Kontakte verboten und Alkohol verboten. Vor den weißen Offizieren musste das
verheimlicht werden.
Die
"Schwarzen" spielten in ihrer Freizeit ein Ballspiel, bei dem mir,
weil ich neugierig zuschaute, ein harter Ball an den Kopf flog. Ich wurde mit
Schokolade überhäuft. Aus ihren Abfalleimern klaubte ich Zigaretten, die von
meinen Eltern gegen andere Dinge eingetauscht wurden. Das durften die
Offiziere nicht mitbekommen. Alles, was verboten war, z. B. Alkohol trinken,
Kontakt mit den Besiegten, wurde mit Prügel bestraft. Die Offiziere führten
zu diesem Zweck Peitschen mit. Am
Ortsrand kippten die Amis ihren Abfall ab. Das war ein Paradies für uns
Kinder. Apfelsinen, Zigaretten, Kaffeebohnen und vieles mehr konnten wir dort
aussortieren und heimbringen.
Die
Amerikaner registrierten und beschlagnahmten alle Warenbestände im Lager
meines Vaters, unter anderem 7 Ballen Leder. Leder in Ballen wurde
normalerweise gewogen. Die Amerikaner haben aber nur gezählt. Das nutzte mein
Vater aus: von den 7 dicken Lederballen wurde jeweils ein Teil abgezweigt und
bei Seite geschafft. Auf diese Weise konnte er den Betrieb notdürftig aufrecht
erhalten und das kam unserer Familie indirekt auch zu Gute. Im
Herbst fing die Schule wieder an. Damit endete die Zeit der längsten und von
unvergessbaren Eindrücken geprägten Ferien meines Lebens. Der Autor Otto Röver wurde 1937 geboren. Die Familie lebte In Düsseldorf. Die Firma des Vaters wurde 1943 durch Bombenangriffe zerstört. Sie wurde deshalb nach Würzburg verlegt. Röver besuchte dort die Grundschule und das Real-Gymnasium. Die Familie zog 1949 wieder nach Düsseldorf. Nach Heirat und beruflich bedingtem Aufenthalt in Frankreich wurde 1985 Nürnberg der neue Wohnsitz. Nürnberg im Jahre 2020 ZUGFOTKOENIGRED2HTM |